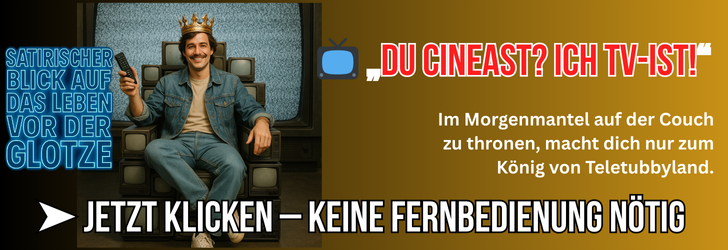Die Nuthe – über 65 Kilometer mit einem Höhenunterschied von bis zu 60 Metern von der Quelle südlich von Jüterbog bis zur Mündung in der Havel bei Potsdam – hat nicht nur die Landschaft, sondern auch die Geschichte von Brandenburg geprägt.
Der Name Nuthe kommt vermutlich noch von den Germanen, den alten Schwaben, die hier vor den Slawen siedelten. Die Übersetzung dürfte ‚Graben‘ sein und lebt noch in der Nut – wie Fuge – weiter. Und das trifft es mit Blick auf die Entstehung nach der Eiszeit recht genau.
Andere Thesen beziehen sich auf ‚Fluss der Not‘ – der Überschwemmungen wegen – oder auf das niederländische ‚noda‘, was Sumpfniederungen bedeutet. Sie entstand durch das Schmelzwasser des Gletschers, der das ganze Tal formte, und blieb mit dessen Furche ein Schmelzwasser-Fluss, der immer wieder über die Ufer tritt. Bis zur Regulierung war das der Normalfall. Bei Hochwasser wird die Durchflussmenge reduziert, womit man einen Unterschied von bis zu fünf Meter ausgleichen kann. Der höchste Wert wurde 1996 mit 4,86 Meter gemessen.
Bis ins 19. Jahrhundert war die Bezeichnung Nuthe verbunden mit dem Quellbach, die A, Ahe oder Agerbach, der dann den oberen Teil bezeichnete.
Fontane und die Nuthe
Im Jahr 1882 schrieb Theodor Fontane unter anderem über die Nuthe und Nieplitz:
„Wer tagelang [..], an Nieplitz oder Notte herumgewandert ist, der blickt, wenn er eines Flusses, wie die Havel, wieder ansichtig wird, auf ihre blauen und seenreichen Flächen, als zöge die Wolga an ihm vorüber.“
Die geringe Fließgeschwindigkeit ist bei der Nuthe tatsächlich nicht auszumachen. Es erscheint wie ein stehendes Gewässer. Dabei war der Fluss einstmals bis zu 40 Meter breit und teils schiffbar, worauf man vor allem Holz beförderte.
Dennoch berichten Urkunden des Mittelalters über einige Mühlen an dem Fluss. Außerdem diente der Fluss den Nuthekrebsen als Heimat, die eine Delikatesse der Region waren. Über ihren Verbleib gibt es allerdings keine Informationen.
Grenzfluss Nuthe – voller Burgen
Die Menschen siedelten zuerst immer an den Gewässern. Bei der Nuthe war es ebenso. Wann das eingesetzt hat, ist aber nicht bekannt. In Woltersdorf gab es Funde aus der Steinzeit, aus der Bronze- und der Eisenzeit. Slawische Funde fehlen jedoch. Auch andere Orte waren schon während der Steinzeit besiedelt: Jütchendorf mit slawischen Funden, einer Burg und sogar Hinweise auf die Römer.
Von den slawischen Funden wissen wir, dass sie den Fischbestand in der Nuthe sehr zu schätzen wussten. Die Slawen gingen in den deutschen Kolonien ab 1130 auf. Albrecht der Bär siedelte Bauerhöfe zur Herrschaftssicherung an. Gerade in jener Zeit war die Nuthe ein Grenzfluss zwischen der Zauche und dem Teltow. Zur slawischen Zeit siedelten die Spreewanen mit Köpenick auf dem Teltow. Die Heveller kontrollierten die Burg Spandau und die Zauche. Um die Grenze gegenüber den Spreewanen mit Jaxa als Anführer zu sichern, bauten sie sogenannte Slawenburgen. Es waren runde Holz-Erde-Konstruktionen, die Schutz vor Angriffen boten. Die Burgen stammen von den Hevellern. Die Spreewanen hatten vermutlich ähnliche Konstruktionen zur Herrschaftssicherung aufgebaut.
Die Heveller verbündeten sich unter Pribislaw-Heinrich, der sich zum Christentum bekannte, mit dem sächsischen Markgraf Albrecht I. Er setzte ihn sogar als Erben ein, was den Konflikt mit den Spreewanen aufflammen ließ. Albrecht der Bär ging aus dem Krieg als Sieger hervor und auch die Deutschen Herren sicherten das Land mit Burgen. So eine Burg im Auftrag des Markgrafen entstand in Trebbin, Beuthen oder in Saarmund, wo man die deutsche Burg auf den Grundfesten der slawischen Burg errichtete.
Nuthe und Napoleon
Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Nuthe begradigt, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Die Auenwälder, die den Verlauf der Nuthe prägten, wichen Wiesen zur Nutztierfütterung.
Ein weiteres Hochwasserereignis war zum Ende des 19. Jahrhunderts, das mit hohen Schäden verbunden war. Der Tierwelt war es gleichwohl ein wichtiges Highlight im Kalenderjahr.
Diese Szenerie muss man sich vorstellen, als die Grande Armee 1813 über die Nuthe nach Berlin marschierte. Es war der 22. August, ein Tag vor der Schlacht bei Großbeeren, als die Nuthe über das Ufer hinaus anschwoll und den französischen Vormarsch stoppte – für einen Tag.
Ansonsten hätte die Schlacht bei Großbeeren am 22. August bzw. woanders stattgefunden. Womöglich auch mit einem anderen Ausgang?
Die Schlacht hätte sich nördlicher abgespielt, weil die Grande Armée besser vorangekommen wäre – gute 15 bis 20 Kilometer nördlicher. Die Koalitionstruppen hätten sich nicht so schnell positionieren können, was einen französischen Sieg begünstigt hätte. Die militärischen Kräfte der Koalition wären verteilter gewesen.
Da der Regen beim Ausgang der Schlacht von Bedeutung war, muss man auch diese Frage einbeziehen. Der Regen, der auch die Nuthe zum Überlaufen brachte und der schon länger andauerte. So regnete es auch an jenem 22. August. Es wäre wieder zu einem Gemetzel mit Bajonetten gekommen. Der Ausgang vielleicht anders, allerdings ist die Verteidigung immer einfacher als der Angriff.
Würde man annehmen, die Franzosen hätten gewonnen, hätte sich die Weltgeschichte verändert. Wäre Napoleon 1813 bis Berlin marschiert, wäre die Moral sicherlich unterminiert worden. Die Stadt war militärisch kaum gesichert. Hätten sich Österreich oder Russland aus der Koalition gelöst? Die Folgen wären weitreichend.
Angeln und Verschmutzung der Nuthe
Die Nuthe ist abschnittsweise ein wichtiger Fluss für Lachse und andere Fischarten, die lange Strecken zurücklegen. Allerdings sollte man vom Angeln absehen, da das Wasser einen hohen Anteil an fettlöslichem Tributylzinn (TBT) mit sich führt, das den Hormonhaushalt von Lebewesen verändert. Es stammt aus Industrieabwasser, wie auch die Belastung der Rieselfelder.