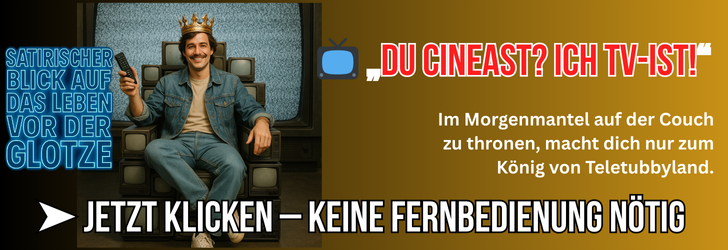Hunderter Märzgefallener kostete das wankelmütige Handeln des Königs ihr Leben, bevor er auf die Forderungen der Revolutionäre einging. Je mehr Menschen starben, desto stärker erwuchs der Wille zur Demokratie. Der preußische König stand aber nicht zu seinem Wort und nahm alle Zugeständnisse zurück. Dabei rückte Zehlendorf in den Fokus der Aufmerksamkeit.
Die Frage der Schuld kursierte angesichts so vieler Toter durch die Barrikadenkämpfe. Auch der bereits versetzte Prinz Wilhelm, Bruder des Königs Friedrich Wilhelm IV, geriet zwischen die Fronten. Er musste sich in der Zitadelle Spandau verstecken, weil er mit den Toten in Verbindung gebracht wurde. Die Bevölkerung aber vergab schnell und die preußische Monarchie konnte – anders als in Frankreich – weiterbestehen. Hieraus folgerte der Ruf, die Preußen wären zu sehr Untertanen.
Zunächst gab sich der König den Anschein, er würde Reformen zulassen. Noch am 21. März wurde eine Bürgerwache eingeschworen. Die einst verbotenen Farben: Schwarz, Rot, Gold zierten nun die Armbinde des Königs. Am zweiten April wurde ein Landtag einberufen, um sich zu konstituieren und man versprach erneut eine Verfassung, ordentliche Gerichte und Mitbestimmung. Es galten nun Presse- und Versammlungsfreiheit. Ein Staatsmodell nach dem Vorbild Großbritanniens.
Die Belange der Arbeiter, der Frauen und der Handwerker blieben unbeachtet, obwohl sie die Revolution erbrachten.
Die Märzgefallenen wurden am 22. März abermals aufgebahrt – am Gendarmenmarkt. Zehntausende erwiesen ihnen die letzte Ehre. Dann wurden sie zum Friedhof Friedrichshain gebracht, der damals noch außerhalb der Stadt lag.
Sie galten als Symbol des Widerstands, den die preußische Regierung bereits zu Beginn brechen wollte. So wurde ein Polizeiaufgebot zu den Gedenkfeiern bestellt, wenngleich sie der Tausenden kaum Herr werden konnten. Noch 1873 fanden sich zum Gedenktag über 10.000 Menschen auf dem Friedhof zusammen, dabei kam es zu Ausschreitungen mit der Polizei.
Reformen waren vorgetäuscht
Noch 1849 wendete sich das Blatt gegen die Revolution, der König reagierte. Der preußische Monarch blockierte die Nationalversammlung, legte Steine in den Weg und desavouierte ihre Beschlüsse. Die Fassade sollte Zeit zur Restrukturierung des Militärs geben, das im Herbst Berlin im Visier hatte. Auch Wien wurde von den Habsburgern zurückerobert. Am 9. November wurde Berlin vom preußischen Militär belagert und am 10. November waren die revolutionären Soldaten geschlagen. Noch im Dezember entmachtete Friedrich Wilhelm IV, das Parlament und verlieh sich mehr Macht durch eine neue Verfassung von Gottes Gnaden. Die Reformen waren zurückgenommen worden und die Monarchie vollumfänglich wiederhergestellt – mit Zensur, ohne Freiheiten oder Rechte. Die Revolution, so der König, war eine Sünde gegen Gott. Die Bannmeile, in der es keine Demonstrationen geben dürfte, reichte bis nach Zehlendorf.
Demokratie-Demonstration am Ende der Bannmeile in Zehlendorf 1849
Ein Aushang war zu lesen, auf dem für den 4. Mai 1849 zu einer Volksversammlung gerufen wurde. Denn zwei Meilen entfernt vom König durfte das Volk seine Meinung noch äußern. Die geschlagene Revolution wurde aus dem Stadtbild verdrängt. Die zweite Meile, heute noch durch den Meilenstein gekennzeichnet, markiert die Stelle, ab wo das verkrüppelte Versammlungsrecht galt.
Der Treffpunkt lag auf einem Feld neben der Chaussee, kurz nach dem Meilenstein. Eine Deutschlandfahne sollte den Weg weisen. Den Aufruf startete ein Publizist und Herausgeber einer demokratisch-gesinnten Zeitung namens Held.
Zur ordnungsmäßigen Anmeldung ging er zum Schulzenamt in Zehlendorf. Dort hörte man sein Anliegen zwar an, aber ließ den Helden in Unkenntnis darüber, dass die zuständige Stelle in Berlin war. Vermutlich war das Absicht, denn es gab keine Begeisterung für die subversiven Elemente aus der Stadt, die die Felder Zehlendorfs zertreten würden. Zehlendorf war in jenen Tagen eine landwirtschaftlich geprägte, ländliche Gegend. Die große Stadt war zwar mit dem Zug zu erreichen, aber dennoch weit weg.
Zu diesem Hintergrund gesellte sich für den Herrn Held noch eine Lawine Pech.
Rechtzeitig 24 Stunden vorher, so dachte aber Held, wurde die Veranstaltung angemeldet. Also beeilte er sich, die Demonstration in der National-Zeitung zu bewerben. Dort verweigerte man jedoch die Annahme, da sie 10 Minuten nach Schluss eingegangen sei.
Er bewarb daher die Versammlung mit Zetteln. Auch wenn das legal war, die Polizei konfiszierte die Blätter und untersagte die Fortführung. Und als er hörte, dass der Zug der Stammbahn wegen Arbeiten an jenem 6. Mai nicht in Zehlendorf hielt, sagte er die Veranstaltung mit weiteren Zetteln ab. Doch das wurde als Finte der Royalen gesehen, weshalb sie von den Sympathisanten wieder entfernt wurden.
Daher versammelte sich an jenem Tag zu Helds Verwunderung eine Menge Menschen an dem vereinbarten Platz hinter dem Meilenstein. Darunter waren auch Soldaten des Königs und der Landrat von Teltow, zu dessen Einflussgebiet Zehlendorf gehörte, und forderte Held auf, die Veranstaltung aufzulösen.
Held verwies auf Artikel 27 der Verfassung. Aber erst jetzt wurde ihm klar, dass er die Anmeldung im Amt Mühlenhof in Berlin hätte machen müssen. Denn Zehlendorf, einst klösterliches Gebiet, wurde von königlichen Ämtern verwaltet.
Die Veranstaltung wurde aufgelöst, wie der Kummer der Demokraten im anschließenden Besäufnis in Steglitz.
Diese Geschichte ist aus den Chroniken des Heimatvereins Zehlendorf nacherzählt.