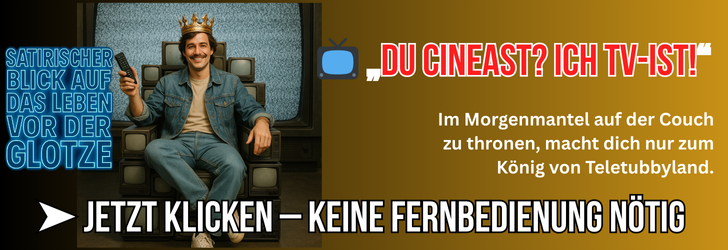Wie aus der Willkür eines Adeligen ein rachsüchtiger Kaufmann wurde: Die Geschichte von Hans Kohlhase und dem spektakulären Silberschatz unter der Kohlhasenbrück, die heute anders heißt und den Teltowkanal überspannt. Dieser Schatz wurde nie gefunden.
Wir schreiben das Jahr 1532. Der Kaufmann Hans Kohlhase reitet von Cölln (heute Berlin) nach Leipzig. Der respektierte Händler ist 32 Jahre alt und verheirateter Familienvater. Das Leben ist gut zu ihm.
Nach Leipzig will Kohlhase zum 1. Oktober – dort ist Michaelismarkt. Er ist in Wellaune als er von den Mannen des Lokalherrschers, Günter von Zaschwitz, ins Visier genommen wird und er ist alleine. Er führt ein Pferd und reitet auf dem anderen. Doch dieser Tag wird sein Leben grundlegend verändern. Könnte er zurück zu diesem Tage gehen, würde er anders handeln?
Der Auslöser
Die Dienstmannen verdächtigten Kohlhase wohl allein des Anblicks wegen des Pferdediebstahls. Diese Beschuldigung war nicht ohne, denn auf Pferdestehlen stand die Todesstrafe. Mehr noch, sie behielten die Pferde ein, was wohl mit Handgreiflichkeiten einherging.
Über den genauen Ablauf stritten die Parteien bereits damals, aber Kohlhase wurde offenbar nicht festgenommen. Stattdessen musste er seinen Weg nun zu Fuß bestreiten. Die andere Seite bezeugte eine Aussageverweigerung, einen tätlichen Angriff mit dem Messer durch Kohlhase sowie dessen Flucht.
In Leipzig angekommen, leitete Kohlhase das Verfahren ein und forderte durch den Amtmann von Bitterfeld seine Pferde zurück. Auf der Rückreise hielt er in Wellaune beim Hause Zaschwitz an. Dieser hatte selbst Taschen zu stopfen und stand vermutlich sehr viel schlechter da als der Kaufmann, es war auch die Zeit der letzten Raubritter. So verlangte er Futterkosten in Höhe von fünf oder sechs Groschen (ein Wochenlohn für einen Handwerker) für die unrechtmäßig an sich genommenen Pferde. So viel kostete es wohl tatsächlich ein Pferd zu füttern. Kohlhase aber verbat sich diese Dreistigkeit und so behielt der Grundherr Zaschwitz die Pferde ein, die einen Wert von sicherlich 800 Groschen hatten.
Rechtstag auf Burg Düben
Kohlhase reiste ab und wandte sich an den Kurfürsten von Brandenburg, Joachim I, der es dem sächsischen Kurfürsten, Johann Friedrich I, vorlegen sollte. Das war die zweithöchste Stufe im Reich, danach kam nur noch der Kaiser. Im Mai 1533 wurde der Fall auf dem Rechtstag behandelt, wo Kohlhase die Sache selbst vorstellte. Es ging ihm nicht mehr nur um die Rückgabe der Pferde, er wollte Wiedergutmachung der Ausfälle und die Wiederherstellung seines Rufs.
Doch Kohlhase war bürgerlicher Kaufmann und Zaschwitz war Adeliger. Eine Diskrepanz, die Kohlhase zum Nachgeben verleitete. Er willigte ein, die Gebühr zu bezahlen, um die Pferde endlich zurückzubekommen. Die geforderten Futterkosten stiegen mittlerweile auf zwölf Gulden an.
Als er seine Pferde dann erhielt, waren diese in einem solch miserablen Zustand, dass eines sogar am nächsten Tag starb. Kohlhase forderte Schadensersatz. Aber selbst als er die geforderte Summe reduzierte, lehnte Zaschwitz es ab, überhaupt zum Gerichtstermin zu erscheinen.
Die Fehde
Die Fehde ist ein Relikt des Mittelalters, das schon zu der Zeit keine offizielle Wirkung mehr hatte. Aber es war bei privatrechtlicher Auseinandersetzung alte Sitte. Eine Frage der Ehre. Als die Fehde ausstarb, rückte das Duell an seine Stelle. Das legale Mittel war der Rechtsweg, auch in jenen Tagen. Doch diesen Weg, so dachte es sich wohl Kohlhase, war er lang genug erfolglos gegangen und erklärte dem Junker Zaschwitz und dem ganzen Fürstentum Sachsen im Frühjahr 1534 die Fehde!
In Sachsen reagierte man sofort und ließ nach ihm fahnden. In Brandenburg sah man sich außerpflicht etwas zu unternehmen, da er sein Geschäft auf- und seine Bürgerrechte zurückgegeben habe.
Vermutlich war Kohlhase recht rachsüchtig, aber sein Vorgehen war durchdacht; denn sein Ziel war die Wiedergutmachung. Das Druckmittel, das ihm zur Verfügung stand, war Terror. Er ging mutmaßlich in entsprechende Kneipen, um eine Handvoll zwielichtiger Personen anzuwerben. Sie hatten den Auftrag, Unruhe und Brände zu stiften. Als Ziel diente alles, was mit dem Kurfürsten Sachsen oder dem Junker Zaschwitz zu tun hatte.
Sie kamen nachts – eine kleine Gruppe von Leuten. Sie legten Feuer und machten sich wieder davon. Die Bezahlung der Leute kostete und richtete noch mehr Schaden an. Daher forderten sie auch mal etwas aus der Kasse. Um etwaigen Häschern zu entwischen, mussten sie nur die Landesgrenze übertreten. Dort war die Reise für die sächsischen Verfolger zu Ende.
Die ersten Flammen züngelten bereits im Jahr 1534 in der Nähe von Leipzig hoch. Auch in Wittenberg brannte es. Und über kurz oder lang, das war klar, loderten die Flammen am Hofe des Zaschwitz.
Erneuter Verhandlungswille scheiterte, obwohl eine gütliche Einigung so nah schien. Die betroffenen Städte riefen zur Diplomatie. So durfte er im Dezember 1534 nach Jüterbog reisen, wenn er seine Unschuld in puncto Brände beweisen könne. Günter von Zaschwitz hatte bereits das Zeitliche gesegnet, sodass seine Erben die Verhandlungen führten. Der Unschuldserklärung kam Kohlhase per Eid nach. Er forderte Wiedergutmachung von den Erben, die erst nach seinem dramatischen Auftritt nachgaben – ihn aber etwas herabhandelten. Die Anschuldigungen des Diebstahls wurden feierlich zurückgenommen und der Konflikt war gelöst. Ein Sieg der Diplomatie oder ein Sieg des Terrorismus?
Der tiefe Fall der Diplomatie
Es dauerte nur wenige Tage bis der Kurfürst von Sachsen das Urteil aufhob. Fürchtete er Nachahmer oder wollte er Schadensersatz für die gelegten Brände? Die Fahndung nach Hans Kohlhase wurde wieder in Kraft gesetzt und abermals brach der Adel das Recht. 100 Taler setzte der Kurfürst von Sachsen auf Kohlhases Kopf aus. Diese enorme Summe entsprach dem Lohn eines Handwerkers für zwei Jahre oder auch dem Preis für zwei gute Pferde.
Selbst die Worte des auch damals bekannten Predigers Martin Luther, die er brieflich an ihn richtete, verwarf Kohlhase – er würde nicht ohne Rache und Gewalt aufgeben.
Die Geschichte von Kohlhases Taten machten die Runde und so manche Nachahmer mag sich gefunden haben, sowohl in Sachsen als auch Brandenburg. Kohlhase ging derweil auch zu Überfällen über und das wohl nur in Sachsen. Denn 1536 erhielt er vom neuen Kurfürsten Joachim II einen Geleitbrief, wonach man ihn wegen der Fehde weder festnehmen, noch nach Sachsen ausliefern darf. Die Gewalt ebbte ab.
Kohlhase drohte aber weiter damit, den Terror über Sachsen zu bringen. Ein neuer Rechtstag musste 1537 her. Abermals stellte er Schadensersatz, aber Sachsen war nicht bereit. Selbst ein Gericht würde dem nicht stattgeben, so die allgemeine Meinung. Die Geleitbriefe des Kurfürsten wurden zwischenzeitlich aufgehoben.
Kohlhase ging daher 1538 wieder zurück zu seiner bisherigen Strategie, aber anderer Taktik. Die Fehde nahm abermals Fahrt auf. Dieses Mal setzte er auf Geiselnahme nach mittelalterlichem Vorbild und entführte den Kaufmann Georg Reiche aus Wittenberg. Doch einige Tage später konnte er bei einem Aufeinandertreffen mit sächsischen Truppen entkommen. Das empfand Kohlhase, ganz in alter Tradition verhaftet, als ehrlos.
Die Häscher aus Sachsen hatten die Faxen dicke und wagten den Grenzübertritt. Das führte zu einer wahren Hexenjagd in Brandenburg. Die sächsischen Handlanger nahmen zahllose Verhaftungen vor, sie folterten und richteten – mit bis zu 40 Personen – mehr Menschen hin, als es tatsächlich gewesen sein können. Darüber hinaus wurden 300 Personen verhaftet. Noch bis ins Frühjahr 1539 wüteten die sächsischen Häscher, obwohl der Widerstand zunahm und die Sympathien für Kohlhase stiegen.
Kohlhase und seine vielleicht fünfköpfige Bande entkamen. Im November 1538 plünderte er Marzahna mit 35 Mann, wobei nicht alle Fakten gesichert sind. Es verging die Zeit mit weiteren Geiselnahmen und weiteren Versuchen, die Behörden in Brandenburg tätig werden zu lassen, da zählte der Kalender das Jahr 1540.

Der Silberschatz in der Bäke
Es war im Frühjahr 1540. Der Schutz des Kurfürsten war aufgehoben und Kohlhase gesucht – quasi die Vorstufe zur Fahndung. Die Sachsen übten immer mehr Druck auf Brandenburg aus, um Kohlhase auszuliefern. Womöglich glaubte Kohlhase, der Kurfürst würde ihn ausliefern. Vielleicht wollte er auch ganz weggehen und brauchte das nötige Startkapital? Er hatte auch einen Komplizen: Georg Nagelschmidt, welcher der Auffassung war, dass der Diebstahl des für Sachsen bestimmten Silbers, ein politisches Beben auslösen würde. Das könnte Kohlhase überzeugt haben. Was es auch war: im Februar warteten Nagelschmidt und Kohlhase auf einen Silbertransport des brandenburgischen Kurfürsten.
Sie lauerten dem Transport bei der ‚Alten Holzbrücke‘, wo heute die Böckmannbrücke ist, auf. Die Bäke schlängelte sich an der Stelle durch den Düppel, damals der Teltower Forst. Den Teltowkanal gab es zu der Zeit noch nicht. Als der kurze Tag im Februar sich dem Abend näherte, stoppten sie den Wagen. Der Kutscher Conrad Dratzieher wurde mit dem Leben bedroht und geschlagen, sodass er mit Mühe flüchten konnte.
Die Beute war enorm, es waren zwischen zwei und fünf Kilogramm reines Silber. Das hatte damals einen Wert von 200 Talern, also vier Jahre Lohn eines Handwerkers. Heute hätte das einen Preis von 3.400 Euro, aber damals war das ein Kaufwert von über 60.000 Euro.
Die beiden vergruben den Schatz an der Brücke und machten sich aus dem Staub. Der Schatz wurde nie gehoben und bei den Bauarbeiten zum Teltowkanal auch nicht gefunden. Aber angeblich liegt er noch im Schlick des Wassers. Wer weiß? Die Brücke erhielt darauf den Namen Kohlhasenbrück, wie der Ortsteil. Aber Kohlhase selbst hat immer geleugnet an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein.
Brandenburg holt zum Gegenschlag aus
Wo Brandenburg bisher recht zurückhaltend war, legte man nun alles daran, des Kohlhases habhaft zu werden. Als Kohlhase im Nikolaiviertel aufgegriffen wurde, befragte man ihn eingehend. Er versteckte sich dort offenbar bei Thomas Meißner, der deshalb samt Familie gleichfalls in Haft kam.
Kohlhase wollte fliehen, so die Ergebnisse der Verhöre. Er versuchte beim Hof Braunschweig-Wolfenbüttel Unterschlupf zu finden. Vielleicht weil man dort nichts vom Protestantismus hielt, den Brandenburg einführte. Andererseits war es ein Adel der alten Schule und Kohlhase legte sich ja offenbar mit diesem Adel an. Die weiteren Verhöre ergaben sogar, dass er plante, den Kurfürsten von Brandenburg selbst zu entführen. Wenn er ein derart großes Risiko eingegangen wäre, wieso dann nicht den Kurfürsten von Sachsen als Zielperson? Die Aussagen wurden sehr vermutlich auch mit der Folter erzwungen.
Der Zauberer vom Hofe Joachims II
Der Kurfürst, Joachim II von Brandenburg, tobte über den Verlust des Silbers, auch weil dieser permanent in Geldnot war. Sein Lebensstil war verschwenderisch und die Staatsausgaben türmten sich. Er baute auch das Jagdschloss Grunewald. Neben dem luxuriösen Lebenswandel des Kurfürsten war er auch ein Anhänger des Okkulten, was damals Mode war. Er beauftragte einen Magier namens Hans damit, ihn zu finden. Hans, der auch Henker war, soll ihn mit Magie nach Berlin gelockt haben.
Kurzer Prozess: Kohlhase wird hingerichtet
Ein Monat nach der Tat, am 22. März 1540, begann der Prozess gegen Kohlhase und weitere Beschuldigte. Neben dem Überfall auf den Silbertransport standen Brandstiftung, Geiselnahme, Erpressung und die Fehde selbst auf der Anklageschrift.
Mit einer vor Beharrlichkeit strotzenden Rede, versuchte sich der beschuldigte Terrorist Kohlhase zu erklären und zu verteidigen. Er rechnete mit einer Geldbuße, da er sich grundsätzlich im Recht sah. Doch das Urteil war hart. Hans Kohlhase wurde, wie die meisten Beschuldigten zum Tode durch Rädern verurteilt, was besonders schmerzhaft und brutal ist. Denn Kohlhase lehnte es ab, geköpft zu werden. Damit zeigte er sich gegenüber Meißner solidarisch. Auch der Komplize, Georg Nagelschmidt, wurde zum Tod auf dem Rad verurteilt, aber an einem anderen Tag hingerichtet.
Kohlhase wurde am 22. März 1540, zusammen mit Thomas Meißner, in der Nähe des Straußberger Platzes in Friedrichshain hingerichtet. Den Verurteilten wurden die Knochen gebrochen, um sie auf das Rad zu flechten, an welchem sie verendeten. Die Qualen waren dramatisch und lang.
Hat der Kurfürst das Silber selbst geklaut?
Dass der Adel sich über das Gesetz erhob, war damals mehr die Regel als die Ausnahme – und das blieb auch noch bis zur Weimarer Republik so. Vor diesem Hintergrund, stellt man sich die Frage, warum sollte Hans Kohlhase die Hand beißen, die ihn so lange beschützte – den Kurfürsten von Brandenburg? Der Kurfürst hatte ihm ein Schutzschreiben ausgestellt, sodass er wegen der Fehde mit Sachsen weder verhaftet, noch ausgeliefert werden durfte. Allerdings wurde dieses Schreiben schon Jahre zuvor ungültig.
Dennoch ist es ein großes Wagnis, den Silbertransport zu überfallen und Kohlhase hatte es nie zugegeben. Die Brandstiftungen, das Anwerben von Mordbrennern, die Gewalt und den Terror – all das räumte Kohlhase ein. Warum nicht den Überfall auf den Silber-Transport?
Zudem wurde der Schatz nie gefunden. Die Bäke war nicht sonderlich tief und spätestens beim Kanalbau, hätte man es finden müssen. Das Silber wäre kaum weggeschwemmt worden, da es zu schwer ist. Das soll auch der Grund gewesen sein, warum sie es dort versenkten. Doch diese Information tauchte erst Jahrzehnte später auf.
Vor diesem Hintergrund keimt der Zweifel. War es vielleicht ein weiterer Akt von Adelswillkür? Hat womöglich der Kurfürst selbst das Silber einbehalten? Transportierte die Kutsche damals nur eine Attrappe? Engagierte der Kurfürst selbst zwielichtige Typen, die den Beschuldigten vielleicht ähnelten?
Denn der Kurfürst Joachim II war chronisch pleite. Er war ein Lebemann im Sinne der Renaissance, baute prachtvolle Schlösser und nicht zuletzt kostete die Scheckheft-Diplomatie auch Geld. Dass er kreative Wege für neue Einkommensquellen fand, ist bekannt. Aber er erhöhte auch mehrfach die Steuern. Vor allem die mittelalterlichen Alkohol- und Pachtabgaben sowie die Zölle fanden neue Höhen während seiner Amtszeit. Das Gros stemmte der Silberhandel, dennoch reichte es nicht.
Den höchsten Landesherrn etwas Derartigem zu bezichtigen, hätte die Untertanen sicherlich das Leben gekostet. Es gibt so auch keinen Hinweis auf eine Unterschlagung – genauso wenig wie auf den Verbleib des Silbers. Wenn dies vom Kurfürsten von langer Hand geplant war, erklärt das auch, dass er Kohlhase schon vor dem Überfall suchen (aber nicht finden) ließ. Er wäre jedenfalls ein geeigneter Sündenbock gewesen.
Die Schuld Kohlhases konnte nur einer bezeugen, der Kutscher des Transports: Conrad Dratzieher. Er wurde beim Überfall geschlagen und davongejagt. Es ist unbekannt, ob der Kutscher den Beschuldigten Kohlhase vorher bereits kannte oder gesehen hatte. Ihre Kreise deckten sich nicht wirklich. Seine Beschreibung passte aber auf Kohlhase und seinen Komplizen, was der eindeutigste Beweis war. Allerdings geschah es in der Dämmerung und vielleicht waren ähnlich aussehende Personen am Werk. Der Kurfürst hatte schließlich enorme Mittel. Aber vielleicht wäre auch das herausgekommen, schließlich bräuchte diese Verschwörung einige Mitwissende.
Ob Georg Nagelschmidt tatsächlich einen solch großen Einfluss auf Kohlhase hatte, ist unklar. Die Idee eines politischen Signals erscheint nur wenig sinnhaft, aber auch das lässt sich nicht ausschließen.
Dass der Kurfürst die Geduld verlieren würde, war abzusehen. Die logischste Version ist, dass sie sich mit einem letzten Coup aus dem Staub machen wollten. Aber selbst dann – wohin? Und wo blieb die Beute ab? Vielleicht versorgte Kohlhase damit die Hinterbliebenen?
Es bleiben zu viele Fragen ungeklärt, um ein abschließendes Urteil zu fällen. Aber ich denke, könnte Kohlhase zu diesem Tag 1532 zurückkehren, würde er anders reagieren.
Kohlhaas von Kleist
Die Geschichte des Terroristen, des Freiheitskämpfers, des Widerständlers, des Gerechtigkeitssuchenden, des Selbstjustizlers, des an der Autorität scheiternden Mannes wurde in verschiedenen Versionen erzählt und verändert. Die bekannteste ist „Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist aus dem Jahr 1808, die von den ursprünglichen Erzählungen stark abweicht.

Wo befand sich die Kohlhasenbrück?
- Böckmannbrücke
- 14109 Berlin
- GPS: 52.400130316666235, 13.142354981977599