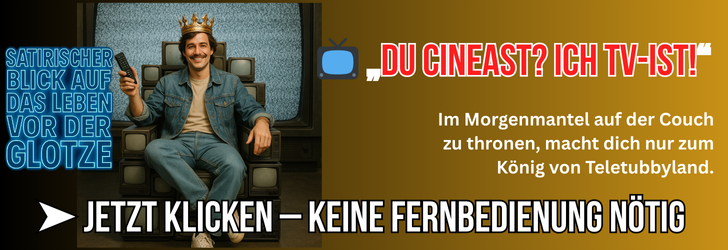Das Symbol für Wohlstand, Selbstdarstellung und weil es an der Zeit dafür war: das Rathaus Steglitz.
Steglitz wuchs durch die Verkehrsführung, die Straße und die Schienen nach Potsdam. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war Steglitz die größte Landgemeinde Preußens – aber keine Stadt. Dennoch wuchs die Bevölkerung und damit auch die Verwaltungsaufgaben. Steglitz hatte damals nur angemietete Räume, aber kein eigenes Rathaus. Das änderte sich 1898.
Bau des Rathauses Steglitz
Steglitz brauchte nicht nur Beratungsräume, es brauchte auch Räume für die Gemeindeverordnetenversammlung, die Polizei und auch die Gerichte wurden später hier untergebracht. Für das neue Selbstverständnis brauchte es aber einen identitätsstiftenden und repräsentativen Bau im Stil der Zeit: dem Historismus. Die Ausschreibung hatte eigentlich Emil Seydel gewonnen. Aus welchem Grund sein Entwurf dennoch nicht umgesetzt wurde, bleibt schleierhaft. Er starb im Jahr der Einweihung des heutigen Rathauses.
Damit wurden 1896 die Architekten Reinhardt & Süßenguth betraut. Es würde ein neogotisches Rathaus mit roten Backsteinen werden, welches sich in den urbanen Charakter, den man anstrebte, einschmiegen würde. Die Neogotik drückt sich an den Spitzbögen, den Fialtürmchen und dem Uhrwerk im Turm aus.
Selbstverständlich brauchte es eine gute Anbindung und daher griff man auf diesen Platz in der Nähe des Bahnhofs zurück, wofür das Dampfbahnrestaurant abgerissen wurde. Schon damals eine Kreuzung.
Das Rathaus wurde im März 1898 eingeweiht. Damit verfügte die Gemeinde Steglitz über eines der auffälligsten Kommunalbauten Preußens.
Das ursprüngliche Eingangsportal des Rathauses und der andere Anbau wurden 2006 – im Namen der Umgestaltung zur Schlossgalerie, also dem Einkaufszentrum – entfernt. Die Eingänge sind dem Trend der Zeit angepasst und der Innenhof überdacht worden. Die Stadtbibliothek zog ebenfalls zu der Zeit ein.
Wandervogel | Jugendrevolte mit Wille zur Natur
Der Ratskeller von Steglitz war ein Treffpunkt für Vereine, politische Gruppen und auch der Jugendbewegungen. So gründete sich in den Räumen des Ratskellers die Bewegung „Wandervogel“. Die Organisation wird mit einer Tafel an der Fassade geehrt. Des Weiteren gibt es einen Gedenkstein im Stadtpark Steglitz und eine weitere Tafel in der Südendstraße.
Der umstrittene Gründer, ein Lehrer namens Karl Fischer, meldete den Wander- und Naturverein an. Die Idee stammte von Hermann Hoffmann als Gegenpol zur zunehmenden Verstädterung und aus Ablehnung der Autoritätshörigkeit. Hoffmann bestimmte Karl Fischer zum Nachfolger. Bei der ‚Staffelstabübergabe‘ bewog Hoffmann Fischer zur Missionierung des Wandergedankens.
Die Mitglieder waren vor allem Schüler des Gymnasiums, die heute Fichtenberg-Oberschule heißt. Sie waren von der Romantik als Gegenbewegung zur Industrialisierung beflügelt. Diese Flügel sollten das Leben im restriktiven Preußen erleichtern.
Zunächst organisierte man Fahrten in den Grunewald, doch der Radius nahm zu. Schon 1898 waren sie im Harz oder in Thüringen zum Wandern. Die Lehrer wurden zu Häuptlingen, die Anfänger zu Wanderfüchsen und die Erfahrenen zu Wanderburschen. Fischer gründete den Verein 1901 unter der Bezeichnung: „Wandervogel – Ausschuß für Schülerfahrten e. V.“
Der Name „Wandervogel“, darüber gibt es zwei oder drei Thesen, referiert vermutlich auf ein Gedicht von Otto Roquette, das die Wandervögel gerne als Lied trällerten. Es könnte auch von der Grabinschrift Kaethe Brancos stammen, der Tochter von Helmholtz, worauf eingeprägt ein Max Jähns Gedicht ebenfalls von Wandervögeln spricht.
Die Wandervögel grüßten sich mit „Heil!“, ihre Anführer wurden „Führer“ genannt, und es gab einen identitätsstiftenden Erkennungspfiff. Karl Fischers autoritärer Führungsstil und die undemokratische Satzung des ersten Wandervogel-Vereins („Ausschuss für Schülerfahrten“) führten 1904 zur Abspaltung einer neuen Gruppe: dem „Wandervogel – e. V. zu Steglitz“. Fischer gründete daraufhin den „Alt-Wandervogel“. Viele Mitglieder wechselten zum demokratischeren Steglitzer Verein. Eine Wiedervereinigung der konkurrierenden Gruppen fand trotz Annäherung nicht offiziell statt.
Die Bewegung erfasste zwischenzeitlich ganz Deutschland und darüber hinaus, wo sich Wandervogel-Vereine und Alternativen gründeten. Viele Fragen der Gesellschaft spiegelten sich in den Wandervereinen.
Konfliktpunkte waren die Mitgliedschaft von Frauen, die Akzeptanz von Homosexualität oder das Trinken von Alkohol. Ab 1910 stand auch der Einfluss der Älteren im Verein in Kritik, es entstand die Bewegung „Jung-Wandervogel“. Keine Bewegung bekannte sich einer Partei zugehörig, was sich nach dem Ersten Weltkrieg relativierte.
In der NS-Zeit wurden diese Vereine gleichgeschaltet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erwuchsen neue Zweige aus der Wandervogel-Bewegung: die Reformbewegung, die Freikörperkultur (FKK) oder die Pfadfinder sind Kinder des Wandervogels.
Wo befindet sich das Rathaus Steglitz
- Schloßstraße 37
- 12163 Berlin-Steglitz
- GPS: 52.45710127496247, 13.32061336221128